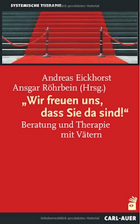Suchergebnisse
Die Expertise gibt einen systematischen Überblick über die Rahmenbedingungen und aktuellen Anforderungen im Feld frühpädagogischer Weiterbildung. Das Autorenteam beleuchtet die zentralen Qualitätsmanagementkonzepte sowie deren Anwendung in Qualitätshandbüchern und ähnlichen Dokumenten. Darüber hinaus untersucht es, ob und inwieweit trägerübergreifende Qualitätsstandards berücksichtigt sowie Kompetenzen im Kontext der (Weiter-)Qualifizierung anerkannt werden.
Ab dem 1. August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Vor diesem Hintergrund untersucht die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige aus verschiedenen fachlichen und fachpolitischen Perspektiven.
Das Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017 präsentiert – wie bereits die erste Ausgabe 2014 – auf Basis der amtlichen Statistik aktuelle Zahlen zu Arbeitsmarkt, Ausbildung und Personal in der Frühpädagogik. Die vorliegende Ausgabe untersucht zudem schwerpunktmäßig die Frage, wie der starke Personalausbau die Zusammensetzung der Beschäftigten hinsichtlich Alter, Gender und Migrationshintergrund verändert hat und gehen auf Herausforderungen im Hinblick auf den Personalbedarf und die Professionalisierung frühpädagogischer Fachkräfte ein.
Das Thema Väter in Therapie und Beratung erlebt unterschiedliche Wellen der Aktualität. Bei der Arbeit mit Familien und Paaren erscheint es heute dringlicher und komplexer denn je. Dieses Buch gibt Beraterinnen und Beratern in verschiedenen Kontexten zunächst im Überblick Konzepte und Forschungsergebnisse an die Hand. Dem folgt eine breit gefächerte Einsicht in bewährte Praxis der Arbeit mit Vätern auf so unterschiedlichen Feldern wie Frühe Hilfen, Suchtberatung, Behinderung, Strafvollzug oder Gewalt.
Der im Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsförderung – Gesundheitsschutz 8 (2018) erschienene Artikel stellt Hintergrund, Ziele und erste Ergebnisse der beiden Studien ZuFa-Monitoring Geburtsklinik und ZuFa-Monitoring Pädiatrie vor.
Die repräsentativen Befragungen sind Teil des Forschungszyklus Zusammen für Familien (ZuFa-Monitoring), mit dem das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) die Qualität der Kooperationen zwischen Akteuren des Gesundheitswesens und Frühen Hilfen untersucht.