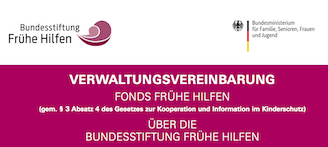Rechtliche Grundlagen
Frühe Hilfen sind innerhalb breiter rechtlicher Rahmenbedingungen angesiedelt. Neben verschiedenen Bundes- und Landesgesetzen zählen dazu weitere Vereinbarungen und rechtliche Grundlagen, zum Beispiel zur Bundesstiftung Frühe Hilfen.
Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) wurden die Frühen Hilfen für Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Säuglingen und Kleinkindern erstmals gesetzlich verankert. Aufbauend auf bereits vorhandene Rechtsgrundlagen erweitert es spezifische Gesetzes- und Aufgabenbereiche und regelt den präventiven und aktiven Kinderschutz durch verlässliche Netzwerke.
Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
Der Hauptteil des BKiSchG, das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), regelt vor allem Aufgaben relevanter Akteure und Rahmenbedingungen für deren Zusammenarbeit.
Im KKG ist auch festgelegt, dass der Bund einen auf Dauer angelegten Fonds einrichtet, der Netzwerke Frühe Hilfen und die psychosoziale Unterstützung von Familien sicherstellt. Dieser Fonds wird seit 2018 mittels der Bundesstiftung Frühe Hilfen umgesetzt.
Sozialgesetzbücher und Schwangerschaftskonfliktgesetz
Das BKiSchG umfasst auch Änderungen an bestehenden Gesetzen, insbesondere Ergänzungen im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII), zum Beispiel § 8a zum Schutzauftrag des Jugendamtes, § 42 zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen oder § 81 zur strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen. In SGB V geht es um Vorsorgeleistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen für Mütter und Väter sowie um Früherkennungsuntersuchungen von Kindern, in SGB IX um vertragliche Regelungen mit Leistungsträgern sowie um Frühförderung. Im Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) wird unter anderem die Möglichkeit nach anonymer Beratung verankert.
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
Das im Juni 2021 verabschiedete Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) rückt Kinder und Jugendliche mit besonderen Unterstützungsbedarfen in den Fokus sowie das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Selbstbestimmung. Es umfasst entsprechende Änderungen in bestehenden Gesetzen, unter anderem auch in den Sozialgesetzbüchern SGB V, SGB VIII und SGB IX sowie im KKG.
Kinderschutzleitlinie
Seit Anfang des Jahres 2019 liegt in Deutschland erstmals eine evidenzbasierte und in Zusammenarbeit mit vielen relevanten Fachgesellschaften und Organisationen entwickelte Leitlinie zum Kinderschutz vor.
Weitere Regelungen und Dokumente
Weitere gesetzliche Regelungen und grundlegende Dokumente können auf den angegebenen externen Websites nachgelesen werden:
- Die UN-Kinderrechtskonvention ist ein Dokument, das die Bedürfnisse und Interessen von Kindern betont. Sie gilt weltweit und enthält zum Beispiel das Recht auf Freizeit, Bildung, Schutz vor Gewalt oder das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit.
- Im Grundgesetz, Artikel 6, sind das Recht und die Pflicht von Eltern zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder gesetzlich verankert sowie das staatliche Wächteramt.
- Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) enthält Regeln für Personen und konkretisiert Aspekte aus dem Grundgesetz. Zum Beispiel im § 1626 zur elterlichen Sorge, § 1631 zum Recht auf gewaltfreie Erziehung und § 1666 zu gerichtlichen Maßnahmen bei Gefährdung des Kinderwohls, aber auch zur Abwägung und der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen.
- Das Strafgesetzbuch enthält Vorschriften zur Strafbarkeit und Strafverfahren, beispielsweise in § 171 bei Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht oder § 225 bei Misshandlung von Schutzbefohlenen.
- Auch Beschlüsse verschiedener Ministerkonferenzen der Länder sind als Grundlage für den Auf- und Ausbau Früher Hilfen, für die Weiterentwicklung der Frühen Hilfen und des Kinderschutzes von Bedeutung. Insbesondere sind dies Beschlüsse der Jugend- und Familienministerkonferenzen, aber auch der Konferenzen der Gesundheitsministerinnen und -minister sowie der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder und Bund-Länder-Beratungen.
- Koalitionsverträge der regierenden Parteien sind zwar keine rechtsverbindlichen Verträge, stellen aber Absichtserklärungen für einen bestimmten Zeitraum dar. Sie sind damit auch von Bedeutung für die Weiterentwicklung von Maßnahmen auf Bundes- oder Landesebene.
Publikationen
Weitere Informationen auf fruehehilfen.de

Kurznachrichten des NZFH per E-Mail
Aktuelles aus Wissenschaft und Fachpraxis, über Publikationen, Projekte und Fachveranstaltungen