Frühe Hilfen aktuell 01/2025
Schwerpunktthema: Wirkungsorientierung
Wirken die kommunalen Angebote der Frühe Hilfen? Helfen sie den Familien? Passen sie zu ihren Bedarfen? Wie lassen sie sich gegebenenfalls verbessern? Und wie kann es gelingen, Ressourcen effektiv einzusetzen? Um diese und ähnliche Fragen geht es beim Thema Wirkungsorientierung.
Die neue Ausgabe Frühe Hilfen aktuell führt in die Thematik ein und skizziert Projekte und Unterstützungsangebote des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) für Kommunen und Netzwerke.
Sebastian Ottmann, Leiter des Kompetenzzentrums Wirkungsorientierung in der Sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, erläutert im Gespräch, warum er jedem Netzwerk empfehlen würde, sich mit Wirkungsorientierung auseinanderzusetzen.
Erfahrungen aus der Praxis berichten Susanne Lein und Sara Gebert. Sie nehmen am NZFH-Projekt "Frühe Hilfen qualitätvoll gestalten: Prozessbegleitung kommunaler Netzwerke" teil.
Zum Herunterladen
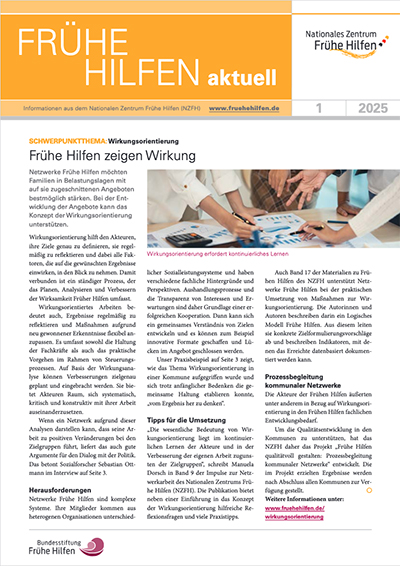
Frühe Hilfen zeigen Wirkung
Netzwerke Frühe Hilfen möchten Familien in Belastungslagen mit auf sie zugeschnittenen Angeboten bestmöglich stärken. Bei der Entwicklung der Angebote kann das Konzept der Wirkungsorientierung unterstützen.
Wirkungsorientierung hilft den Akteuren, ihre Ziele genau zu definieren, sie regelmäßig zu reflektieren und dabei alle Faktoren, die auf die gewünschten Ergebnisse einwirken, in den Blick zu nehmen. Damit verbunden ist ein ständiger Prozess, der das Planen, Analysieren und Verbessern der Wirksamkeit Früher Hilfen umfasst. Wirkungsorientiertes Arbeiten bedeutet auch, Ergebnisse regelmäßig zu reflektieren und Maßnahmen aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse flexibel anzupassen. Es umfasst sowohl die Haltung der Fachkräfte als auch das praktische Vorgehen im Rahmen von Steuerungsprozessen. Auf Basis der Wirkungsanalyse können Verbesserungen zielgenau geplant und eingebracht werden. Sie bietet Akteuren Raum, sich systematisch, kritisch und konstruktiv mit ihrer Arbeit auseinanderzusetzen.
Wenn ein Netzwerk aufgrund dieser Analysen darstellen kann, dass seine Arbeit zu positiven Veränderungen bei den Zielgruppen führt, liefert das auch gute Argumente für den Dialog mit der Politik. Das betont Sozialforscher Sebastian Ottmann im Interview.
Herausforderungen
Netzwerke Frühe Hilfen sind komplexe Systeme. Ihre Mitglieder kommen aus heterogenen Organisationen unterschiedlicher Sozialleistungssysteme und haben verschiedene fachliche Hintergründe und Perspektiven. Aushandlungsprozesse und die Transparenz von Interessen und Erwartungen sind daher Grundlage einer erfolgreichen Kooperation. Dann kann sich ein gemeinsames Verständnis von Zielen entwickeln und es können zum Beispiel innovative Formate geschaffen und Lücken im Angebot geschlossen werden.
Unser Praxisbeispiel aus Rosenheim zeigt, wie das Thema Wirkungsorientierung in einer Kommune aufgegriffen wurde und sich trotz anfänglicher Bedenken die gemeinsame Haltung etablieren konnte, "vom Ergebnis her zu denken".
Tipps für die Umsetzung
"Die wesentliche Bedeutung von Wirkungsorientierung liegt im kontinuierlichen Lernen der Akteure und in der Verbesserung der eigenen Arbeit zugunsten der Zielgruppen", schreibt Manuela Dorsch in Band 9 der Impulse zur Netzwerkarbeit des NZFH. Die Publikation bietet neben einer Einführung in das Konzept der Wirkungsorientierung hilfreiche Reflexionsfragen und viele Praxistipps.
Auch Band 17 der Materialien zu Frühen Hilfen des NZFH unterstützt Netzwerke Frühe Hilfen bei der praktischen Umsetzung von Maßnahmen zur Wirkungsorientierung. Die Autorinnen und Autoren beschreiben darin ein Logisches Modell Frühe Hilfen. Aus diesem leiten sie konkrete Zielformulierungsvorschläge ab und beschreiben Indikatoren, mit denen das Erreichte datenbasiert dokumentiert werden kann.
Prozessbegleitung kommunaler Netzwerke
Die Akteure der Frühen Hilfen äußerten unter anderem in Bezug auf Wirkungsorientierung in den Frühen Hilfen fachlichen Entwicklungsbedarf. Um die Qualitätsentwicklung in den Kommunen zu unterstützen, hat das NZFH daher das Projekt Frühe Hilfen qualitätvoll gestalten: Prozessbegleitung kommunaler Netzwerke entwickelt. Die im Projekt erzielten Ergebnisse werden nach Abschluss allen Kommunen zur Verfügung gestellt.
Publikationen
Wirkungsorientierung in den Frühen Hilfen
Impulse zur Netzwerkarbeit, Band 9
Monitoring von Frühen Hilfen in Kommunen. Materialienheft zum Logischen Modell
Materialien zu Frühen Hilfen, Band 17